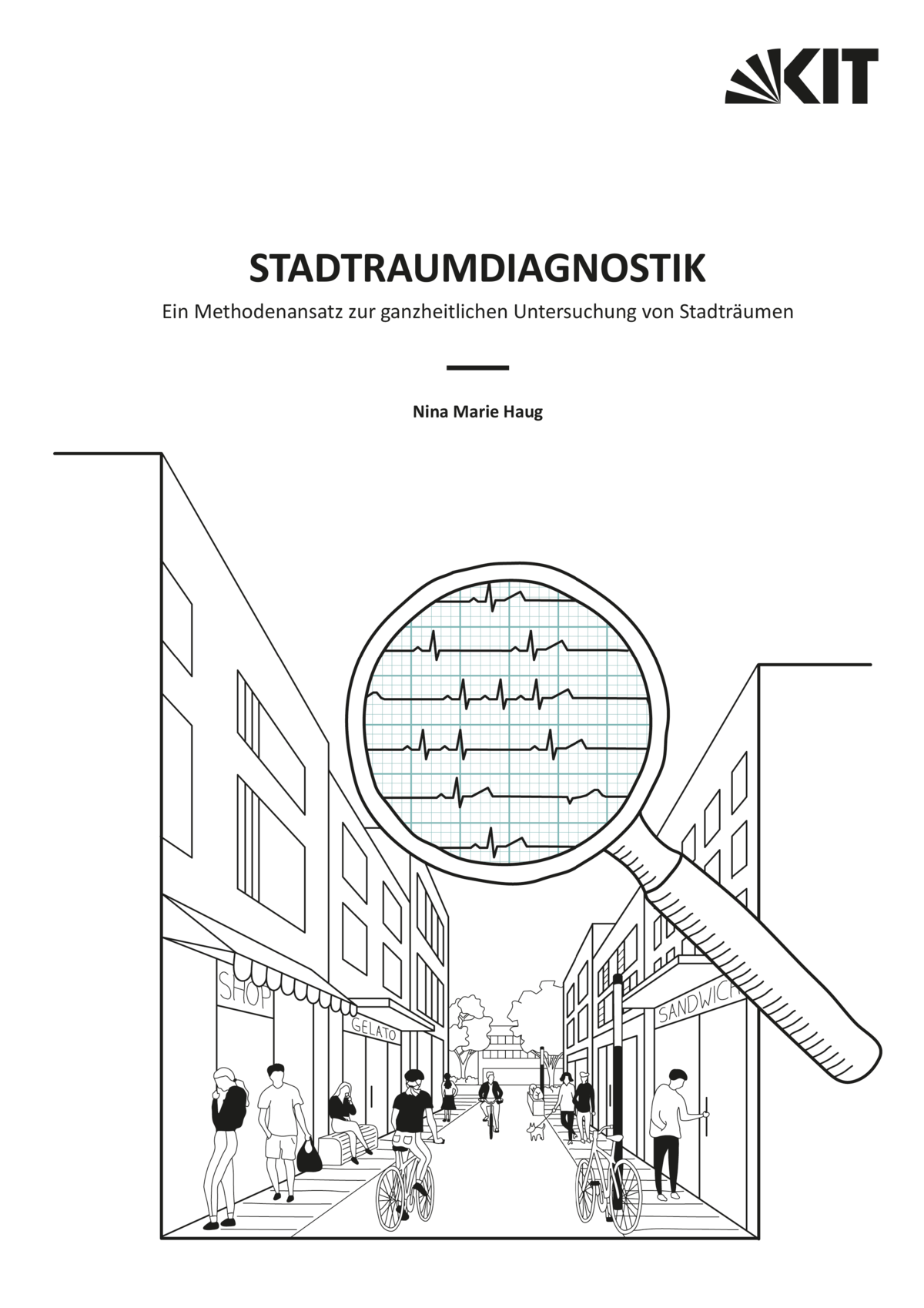Stadtraumdiagnostik: Ein Methodenansatz zur ganzheitlichen Untersuchung von Stadträumen
Karlsruhe, 2025.
Dr. Nina Haug
Öffentliche Räume prägen seit jeher das Erscheinungsbild unserer Städte. Sie bilden die grundlegende Raumstruktur für das öffentliche Leben und sind tief im Wesen der ursprünglichen Europäischen Stadt verankert (Deutscher Städtetag, 2006). In den letzten Jahrzehnten hat sich die Bedeutung öffentlicher Stadträume jedoch stark gewandelt. Denn durch die massiven strukturellen Eingriffe im Rahmen des autogerechten Stadtumbaus und den steigenden Dichtedruck haben sich öffentliche Stadträume nunmehr zunehmend zu „stressigen“ Räumen entwickelt, denen es aus der menschlichen Wahrnehmung heraus deutlich an Attraktivität und Aufenthaltsqualität mangelt.
Mithilfe der Innovation des Emotion Sensings können diese negativen Symptome dichter Stadträume mittlerweile jedoch relativ präzise als Stress-Hotspots identifiziert werden. Daran anknüpfend liegt es nun allerdings in der Verantwortung der Planung, den Ursachen dieser urbanen Stressphänomene auf den Grund zu gehen. Dabei ist es essenziell, die Problemlage aus der menschlichen Wahrnehmung heraus zu betrachten und Faktoren zu identifizieren, die in dichten Stadträumen einen negativen Einfluss auf die Wahrnehmung und Bewegung des Menschen ausüben.
Ausgehend von den nachgewiesenen Stress-Hotspots verfolgt die vorgestellte Methodik der Stadtraumdiagnostik das Ziel, Stadträume ganzheitlich im Hinblick auf Stress auslösende Faktoren zu untersuchen. Mit dieser Methode soll es perspektivisch ermöglicht werden, Einfluss nehmende Stressoren im urbanen Kontext zu identifizieren und frühzeitig in Planungsprozesse einbeziehen zu können. Der erprobte Ansatz macht es sich in diesem Zusammenhang inhaltlich zur Aufgabe, Einflussfaktoren aus unterschiedlichsten Themengebieten gleichermaßen zu berücksichtigen und zu gewichten. Methodisch strebt die Arbeit das Ziel an, die Stressorenanalyse um einen bislang hauptsächlich im Bereich der Stadtplanung bekannten, analogen Werkzeugkasten zu erweitern. Damit werden erstmals sowohl quantitativ messbare „harte“ Faktoren als auch qualitativ beschreibbare „weiche“ Faktoren in einem gemeinsamen Analyseansatz vereint.
Verlag: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe. DOI: 10.5445/IR/1000183263
Kostenloser Downloadlink: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000183263